
Kaum zu glauben, aber die Leverkusener Jazztage feiern dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum. Eine Veranstaltungsreihe, die sich über die Zeit einen großen Nahmen gemacht hat und aus dem Musikkalender auch für den WDR-Rockpalast nicht mehr wegzudenken ist. Großartige Jazzmusiker haben hier in den Jahren ein Gastspiel abgeliefert, aber auch andere Musiksparten wurden in die Jazztage integriert. So stellt auch die Blues Night einen festen Bestandteil dar, die auch wieder vom Rockpalast aufgezeichnet wurde und am 25.11.2019 von 00:45 – 4:15 Uhr ausgestrahlt wird. Das Programm hatte es in sich und es verdient in dieser Form festgehalten zu werden.

Pünktlich, wie im Programm angekündigt, wurde die erste Band vorgestellt und Eamonn McCormack betrat mit seinen beiden jungen Bandmitgliedern Edgar Karg am Bass und Max Jung-Poppe an den Drums die Bühne des gut gefüllten Forums. Der mittlerweile 57-jährige Gitarrist aus Dublin mag für viele ein unbeschriebenes Blatt sein. Dass es sich aber um einen großartigen Blueskünstler handelt, bewies er schon in der Vergangenheit, als er mit Größen wie Rory Gallagher, Nils Lofgren, aber auch unter dem Pseudonym Samuel-Eddy für ZZ Top und Robert Plant, Konzerte eröffnete.
Seine „Liebe“ zur Musik von Rory Gallagher, war während der ganzen Show erkennbar, was auch an den gemeinsamen irischen Wurzeln liegen mag. In den 30 Minuten, die ihm zur Verfügung standen, lieferte er mit seinen Jungs einen starken Blues Rock-Auftritt, der auch beim Publikum entsprechend ankam. Den Beginn bestritt er mit „From Town To Town“ vom aktuellen Album „Like There’s No Tomorrow“, in dem er seine eigene Reise als Musiker von Dublin bis nach Memphis beschreibt. Die folgenden Lieder, „Down And Out“, „Funkytown“ und „Heal My Faith“, alle mit treibender Rhythmussektion und hart gespielten Soli im Stile Gallaghers, mündeten schließlich in „Falsely Accused“, in dem auch Rory mal als Gastmusiker seinen Anteil hatte, aber alle aus der Feder McCormacks stammten.
Fast logische Konsequenz war, dass zum Abschluss des Auftritts mit „Shadow Play“ ein Song von gecovert wurde, der scheinbar wie ein Schatten über die Bühne geschwebt war. In einem Gespräch mit McCormack und Jung-Puppe nach dem Konzert, schilderten diese noch einmal die besondere Atmosphäre der gut besuchten Show und die daraus resultierende Spielfreude, die ihnen aber auch zu jedem Moment des Konzertes anzumerken war. Nach der Show nahm sich McCormack ausgiebig Zeit, um am gut besuchten Merchandising-Stand den Fans, von denen er an diesem Abend mit Sicherheit einige hinzugewonnen hatte, zur Verfügung zu stehen.
Line-up Eammon McCormack:
Eamonn McCormack (lead vocals, electric guitars)
Eddy Karg (bass)
Max Jung Poppe (drums)

Nach einer kurzen Umbauphase, an dieser Stelle kann schon einmal die gut geplante Organisation hervorgehoben werden (die Sets begannen fast minutengenau wie geplant), wurde dann die Kris Barras Band angekündigt. Die Briten legten gleich, mit „Ignite (Light It Up)“ und „Counterfeit People“ los wie die Feuerwehr. Der Beginn war somit identisch mit einem Konzert, vor einigen Wochen in Dortmund, was aber auch nicht verwunderlich ist, da der Auftritt praktisch im Rahmen der eigenen Tour stattfand und der junge Brite auch erst sein zweites Album herausgebracht hat. Für den heutigen Abend hatte er danach aber dann einige Songs ausgetauscht.
So brachte er mit „I Got Time“ ein Stück mit einem gehörigen Southern-Flair auf die Bretter. Mit „What You Get“ und „Vegas Son“ folgten noch einmal zwei krachend vorgetragene Tracks des aktuellen Werks, bei denen der am Bass wild posende Elliott Blackler und Billy Hammett an den Drums, wie ein Derwisch spielend, eine Basis legten, die Josiah J. Manning mit zum Teil virtuosen Keyboardspiel füllte. Einer der Höhepunkte eines starken Konzertes folgte dann mit „Watching Over Me“, einer Hommage an seinen Vater, bei der Barras sich in Soli sprichwörtlich die Seele aus dem Leib spielte, um in einem Moment scheinbar in sich gekehrt in Richtung Himmel zu zeigen, von wo aus sein Vater, dem Titel des Liedes nach, ein Auge auf ihn wirft.
Bluesig bis hart rockend ging es dann mit „Not Fading“ weiter, um mit „Devil’s Done Right“, Blues und Boogie im Stile von ZZ Top zu performen.
„Lovers Or Loosers“ leitete Manning mit einem psychedelischen Keyboard-Intro ein, in das Barras dann südstaaten-ähnlich seine Gitarre einspielte um kurz vor dem Finale etwas Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Ähnlich, mit starken Slide Einlagen, folgte als erste Zugabe mit „Hail Mary“ ein Song, der auch Südstaatenrockern gut zu Gesicht gestanden hätte.
Das Finale Furioso war dann eine scheinbar nicht endende Version von „Going Down“, mit furiosen Gitarrensoli, Bassläufen, krachenden Drums und zünftigen Keyboardeinlagen. Nach etwa einer Stunde verabschiedete sich dann eine bestens aufgelegte Kris Barras Band von begeisterten Publikum. Es ist erstaunlich, mit welcher Bühnenpräsenz der junge Brite, der erst wenige Jahre im Musikgeschäft ist, einen Draht zum Publikum herstellt und auch jedem seiner Mitstreiter die Räume gibt, sich zu präsentieren, sodass der Name ‚Band‘ in diesem Fall absolut zutreffend ist. Wie McCormack nahm sich auch Barras nach dem Konzert ausgiebig Zeit für die Fans, die zahlreich am Merchandising-Stand warteten.
Line-up Kris Barras Band:
Kris Barras (lead vocals, electric guitar)
Elliott Blackler (bass, vocals)
Josiah J. Manning (keys, vocals)
Billy Hammett (drums)

Um 21:45 betrat dann der Main-Act, Kenny Wayne Shepherd, diesmal im Vergleich zum Konzert im Sommer mit Beth Hart, mit „Bigband“ die Bühne. Zur bekannten Besetzung mit Noah Hunt (guitar, vocals), Scott Nelson (bass), Joe Krown (keyboards) und Chris Layton (drums) gesellten sich an diesem Abend noch Joe Sublett (saxophone) und Mark Pender (trumpet) hinzu. Diesmal ergänzte Shepherd die Setlist um einige Songs, da ihm als Headliner ein größerer Spielraum gegönnt wurde.
Nach einem dramaturgischen Intro vom Band mit Bandvorstellung ließ Shepherd in dieses tiefe Töne seiner Gitarre klingen, sodass man diese scheinbar am Körper spüren konnte, um dann mit „Woman Like You“ die Show zu eröffnen. Durch die Bläsersektion wurde der Sound noch voluminöser als er ohnehin schon war. Nachdem ein sichtlich gut gelaunter Protagonist das Leverkusener Publikum begrüßt hatte, legte er den von Neil Young geschriebenen Buffalo Springfield-Klassiker „Mr. Soul“ in einer harten bluesrockigen Version nach.
Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatte die Band die Fans hinter sich gebracht. Neben dem wie gewohnt starken Gitarrenspiel Shepherds, konnte auch Noah Hunt gesanglich voll überzeugen. Im weiteren Verlauf unterstützte er Shepherd, der dann auch in vielen Songs den Leadgesang übernahm, sowohl an der elektrischen als auch der akustischen Gitarre. Über die spielerische Klasse Laytons an den Drums Worte zu verlieren erübrigt sich. Diese bewies er schon an der Seite von Stevie Ray Vaughan in Band sowie Storyville oder Arc Angels, etc. und bot Shepherd zusammen mit Scott Nelson, der den Bass auf den Punkt brachte, die Grundlage, sich in vielen der Songs an der Gitarre auszutoben, was er beim knüppelhart performten „Long Time Running“ auch entsprechend tat.
Bei „I Want You“ hatte dann Keyboarder Joe Krown seinen ersten ganz großen Auftritt mit einem überzeugenden Honkytonk-Solo. Ganz stark das folgende „Diamonds & Gold“ mit treibenden Rhythmus, einer fast singenden Gitarre Shepherds und starken Rhythmusspiel von Hunt, der sich dazu die Gitarre umgeschnallt hatte. Hervorzuheben auch der wechselweise Gesang der beiden Genannten. Beim Elmore James-Cover „Talk To Me Baby“ wurde es dann richtig bluesig und Joe Sublett am Saxofon und Mark Fender an der Trompete sorgten für regelrechtes Bigband-Feeling, was das Publikum sichtlich begeisterte.
Mit „Heat Of The Sun“ und „Down For Love“ wurde es etwas ruhiger und leichtes Southern-Luft erfüllte das Forum, welches sich bei „Turn To Stone“ fortsetzte und nur durch den Slowblues „Shame, Shame, Shame“ (natürlich mit brachialem Gitarrensolo endend) kurz unterbrochen wurde. Darauf verließ die Band die Bühne, um nach frenetischem Applaus, für insgesamt drei Zugaben noch einmal zurückzukommen.
Das Southern-lastigen „Blue On Black“, wieder mit starken Soloeinlagen Shepherds, sowie das treibende „I’m A King Bee“ (toller Gesang von Noah Hunt) leitete dann ein furioses Finale ein. In einer ausgedehnten Version des Jimi Hendrix-Klassikers „Voodoo Child (Slight Return)“ entfachte Shepherd brachiale Soli, die er bildlich in Richtung Publikum abfeuerte. Seine furiose Bläsersektion, Krown mit Soloeinlagen am Keyboard und die stampfende Rhythmussektion um Layton und Nelson, erstürmten die Halle regelrecht. Das danach nichts mehr kommen konnte, war eigentlich jedem klar.
Line-up Kenny Wayne Shepherd:
Kenny Wayne Shepherd (electric guitar, vocals, lead vocals)
Noah Hunt (lead vocals, electric and acoustic guitar, percussion)
Joe Krown (keys)
Scott Nelson (bass)
Chris Layton (drums)
Joe Sublett (saxophone)
Mark Pender (trumpet)
Fazit: Dem Team um Fabian Stiens ist es gelungen, hochkarätige Künstler für diesen Abend zu gewinnen, die, auch wenn der Blues verschieden interpretiert wurde, gut zusammen passten. So kam es nicht zu Brüchen im Festival. Auffallend war ein sehr präsentes, immer zuvorkommendes Team, was einen fast familiären Charakter entstehen ließ. Einen großen Anteil an der gelungenen Veranstaltung hatten natürlich auch die bestens aufgelegten Künstler und ein Publikum, das sich durchaus anspornend auf die Musiker auswirkte. Ein Lob auch an die Soundtechniker, die einen gut differenzierten Sound in die Halle brachten und die Lichttechniker, die mit abwechslungsreichen Effekten, auch optisch unterstützten.
Ein Dank an Shooter Promotions und Fabian Stiens für die Akkreditierung und die Möglichkeit sich zum Fotografieren recht uneingeschränkt bewegen zu können, dass es gar nicht nötig war, aus dem abgesperrten Bereich vor der Bühne zu agieren, wo man dann eher die Kamaeraleute des Rockpalast gestört hätte, da das Forum mit seiner terassenförmigen Architektur auch so viele Möglichkeiten bietet.
Bilder und Bericht: Gernot Mangold
Eamonn McCormack
Eamonn McCormack bei Facebook
The Kris Barras Band
The Kris Barras Band bei Facebook
Kenny Wayne Shepherd
Kenny Wayne Shepherd bei Facebook
Shooter Promotions
Leverkusener Jazztage








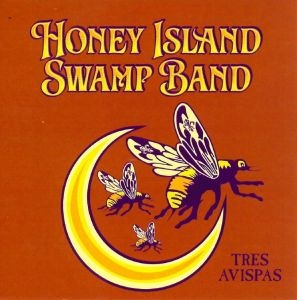

 Aaron Wilkinson drückte mir direkt die neue EP zum Reviewen in die Hand und schenkte mir auch noch ihr früheres Werk „Cane Sugar“. Nachdem dann alle Verkäufe und Autogrammwünsche erledigt waren, hatten die Südstaatler auch noch Zeit für unser obligatorisches VIP-Bild.
Aaron Wilkinson drückte mir direkt die neue EP zum Reviewen in die Hand und schenkte mir auch noch ihr früheres Werk „Cane Sugar“. Nachdem dann alle Verkäufe und Autogrammwünsche erledigt waren, hatten die Südstaatler auch noch Zeit für unser obligatorisches VIP-Bild.



 Das Quartett hat mit „Burning Bridges“ seit einigen Tagen ein, im wahrsten Sinne des Wortes, brandneues CD-Werk am Start (Review auch demnächst bei uns), ein integrierter Showeffekt in Machart des Albumtitelbildes wäre allerdings im kleinen topos von recht ambitionierter und eher nicht empfehlenswerter Natur gewesen…
Das Quartett hat mit „Burning Bridges“ seit einigen Tagen ein, im wahrsten Sinne des Wortes, brandneues CD-Werk am Start (Review auch demnächst bei uns), ein integrierter Showeffekt in Machart des Albumtitelbildes wäre allerdings im kleinen topos von recht ambitionierter und eher nicht empfehlenswerter Natur gewesen…