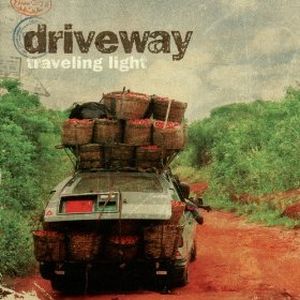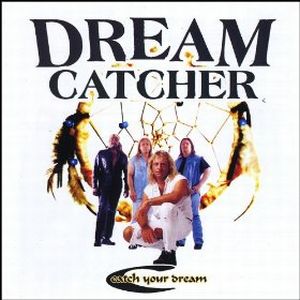Cold Truth sind ein amerikanisches Rock-Quartett und stammen aus Murfreesboro, Tennessee. Ihr Debüt hatte bei den wenigen Insidern hierzulande glänzende Kritiken zufolge, da sie in zeitgemäßer und höchst authentischer Form an die klassischen Rockbands der siebziger Jahre anknüpften. Ihre furiose Cover-Version des Free-Klassikers „Fire And Water“ wusste dabei besonders zu gefallen.
Cold Truth bestehen aus der hervorragenden Rhythmus-Sektion Matt Green (Drums) und Abe White (Bass), dem immer wieder brillant agierenden Lead-Gitarristen Kurt Menck (erinnert an Mick Ralphs) und dem Musiker, der dieser Band so etwas wie ein außergewöhnliches Gesicht verpasst, Thane Shearon (Vocals, Guitar). Shearon ist nicht nur mit einer begnadeten Charakterstimme gesegnet, sondern beweist im Verbund mit Kurt Menck auch noch famose Songwriter-Qualitäten.
Er hört sich an wie eine geniale Mischung aus Paul Rodgers, David Coverdale und Chris Thompson und passt unheimlich gut zum straight rockenden Stil der Band. Die Southern Rock-Fraktion dürfte ihn auf dem letzten All-Star-Tribute-Sampler für Lynyrd Skynyrd schon mal zur Kenntnis genommen haben, als er im Verbund mit Ed King, Artimus Pyle und den Original Honkettes eine fulminante Version von „Double Trouble“ hinlegte, die teilweise auch als Saturday Night Special Band Konzerte geben.
Apropos Ed King. Der ist voller Lobes für Thane Shearon und bezichtigt ihn in einem Interview als denjenigen, der den Skynyrd-Stoff wohl gesangstechnisch am besten beherrscht und erteilt seinen früheren Kollegen damit eine kleine Breitseite. Ihrer guten Beziehung zu einander sei Dank, hat man auf „Do Watcha Do“ die Gelegenheit Ed Kings Gitarrenkünste wieder mal ein paar Minuten genießen zu dürfen, denn der bedient die Slide-E-Gitarre beim starken „If That Ain’t Enough“, einem der vielen Highlights dieser durchgehend selbst komponierten Scheibe. Klasse hier auch die rotzigen, weiblichen Backs von Nancy Roark.
Die vier Jungs rocken in relativ kompakter Form (man verzichtet scheinbar bewusst auf länger ausufernde Songs) in der Tradition von Bands wie Bad Company (wohl stärkster Einflussgeber), Black Crowes, Humble Pie, AC/DC, Steve Schuffert Band oder Whitesnake (hauchzart), dazu mit einem dezenten Southern Rock-Teint, hat aber den Muff der damaligen Zeit völlig abgelegt. Das ist moderner Rock, ein bisschen bluesig angehaucht, wie er heutzutage sein muss. Klar produziert, gut abgehend, riffig und hochmelodisch. Lediglich bei „Peace With Me“, „Whisper To Me“ und beim tollen, abschließenden „Light My Way“ wird Zeit zum Ausatmen gewährt. Die Empfehlung für Cold Truths „Do Watcha Do“ kann daher nur lauten. Schleunigst kaufen tun!
Eigenproduktion (2009)
Stil: Southern Rock / Hard Rock
01. Cold As Hell
02. Diesel
03. If That Ain’t Enough
04. Gimme Some
05. Set Me Free
06. Peace With Me
07. Shakedown
08. Together
09. This Time
10. Finding The Way
11. Whisper To Me
12. Payin Dues
13. Light My Way