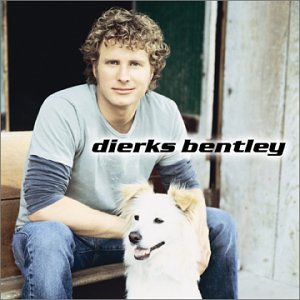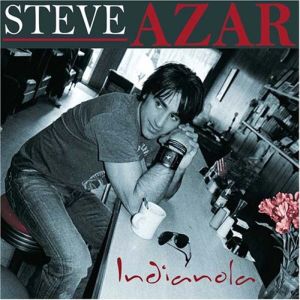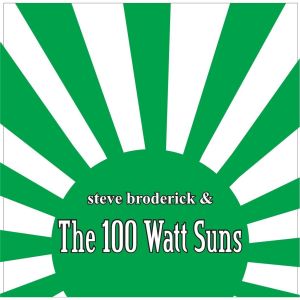Solche Typen hätte man gern an seiner Seite, um in gepflegter Art das eine oder andere Haute-Couture-Treffen, Vernissagen, Promi-Parties und sonstige Bussi-Bussi-Veranstaltungen mal so richtig aufzumischen, oder, um halt Politikern, Managern, Religiösen, Anwälten, Psychologen und allen Leuten, die dieser Welt soviel Freude bereiten, einmal so richtig das Maul zu stopfen. Gäbe sicherlich viel Schlagzeilen und umso mehr Anerkennung!
Aber was machen Kerle wie die von Blackberry Smoke nicht alles, um dann doch lieber in einem so seriösen, vorurteilsfreien und sich natürlich von jeglicher Gewalt distanzierenden Magazin zu erscheinen? Richtig! Sie machen einfach Musik!
‚Die kommen daher wie ein polternder Mülleimer‘, so der Kommentar eines ehemaligen Kollegen, womit er wirklich gar nicht so falsch liegt. Aber wenn man sich natürlich dem Southern-Rock-N-Roll in der Tradition der Georgia Satellites verschrieben hat, gehören ein wenig Proll, Mief, Dreck, Schweiß, Whisky und Bier eben dazu.
Und so brettern die Jungs um Frontmann Charlie Starr durch die Dreiviertelstunde, nehmen allerdings auch mal zwischendurch den Fuß vom Gaspedal wie beim Satellites-Cover „Another Chance“, „Angeline“ oder „Sure Was Good“, was ich persönlich ganz angenehm empfinde.
Richtig gut sind die fetzigen Nummern wie „Train Rollin'“ und „Scare The Devil“ mit allen Gitarrenfreuden, die der Southern-Rock nun einmal bietet. Der alte Outlaws-Schinken „Freeborn Man“ wird in einer Art Highspeed-Version gecovert, so dass man das Original kaum noch erkennt, wenn man den Titel vorher nicht weiß. Trotzdem oder gerade deswegen recht gelungen.
BBS ist eigentlich eher ’ne typische Live-Band mit ernstzunehmenden Anheizerqualitäten. So war es auch sicher nicht verkehrt, drei Live-Stücke zum Antesten mit auf die CD zu packen. Allerdings bedient man sich leider zum Teil diverser von zig anderen Bands schon lange vorher bis zum Erbrechen durchgenudelter Southern-Klischees.
Also vor dem Einlegen erst mal den Alkoholpegel anheben, so dass die Feinfühligkeit ein wenig in den Hintergrund tritt, und die Toleranz gegenüber kleineren Schwächen (Kreativität/Produktion) entsprechend in die Höhe geschraubt wird. Dann hat man sicher seinen Spaß mit dem Teil. Insgesamt was für Biker, Rocker, Rednecks und feuchtfröhliche Männerabende mit verwegenen Typen unseres Schlages. Ey, oder hasse etwa ne andere Meinung? Dann pass bloß auf…
Eigenproduktion (2003)
Stil: Southern Rock
01. Testify
02. Sanctified
03. Another Chance
04. Nothin For You
05. Normaltown
06. Train Rollin
07. Angeline
08. Sure Was Good
09. Scare The Devil
10. Muscadine
11. Freeborn Man
Blackberry Smoke
Blackberry Smoke bei Facebook
Bärchen Records